
Liebe Genoss*innen,ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich auf der kommenden Landeskonferenz für den Landesvorstand der NRW-Jusos kandidieren werde. In diesem Schreiben möchte ich euch einen Überblick über meine Person, meine Juso-Zeit und meine politischen Inhalte geben. Selbstverständlich könnt ihr mich bei Fragen jederzeit unter dennis.schnittke@jusos-koeln.de kontaktieren.

Wenn wir über Geschichte sprechen, sprechen wir meistens über Männer. Könige, Feldherren, Philosophen – das ist das, was wir aus Schulbüchern und Denkmälern kennen. Doch Frauen waren nie einfach nur „dabei“. Sie haben Geschichte gemacht – als Herrscherinnen, Widerstandskämpferinnen, Denkerinnen, Künstlerinnen, Arbeiterinnen und Aktivistinnen. Nur: Ihr Beitrag wurde systematisch verdrängt, kleingeredet oder ganz ausgelöscht.

Am 22.03.2025 kamen rund 300 Genoss*innen der KölnSPD im Bürgerzentrum Chorweiler zusammen, um beim Unterbezirksparteitag richtungsweisende Entscheidungen für die Stadt und den kommenden Kommunalwahlkampf zu treffen

Misogynie – also Frauenfeindlichkeit – ist ein tief verwurzeltes gesellschaftliches Problem. Oft denken Menschen bei diesem Begriff an offenen Hass gegen Frauen, doch in Wirklichkeit ist Misogynie oft subtiler. Sie zeigt sich in doppelten Standards, abwertenden Kommentaren und unbewussten Denkmustern, die Frauen systematisch benachteiligen.
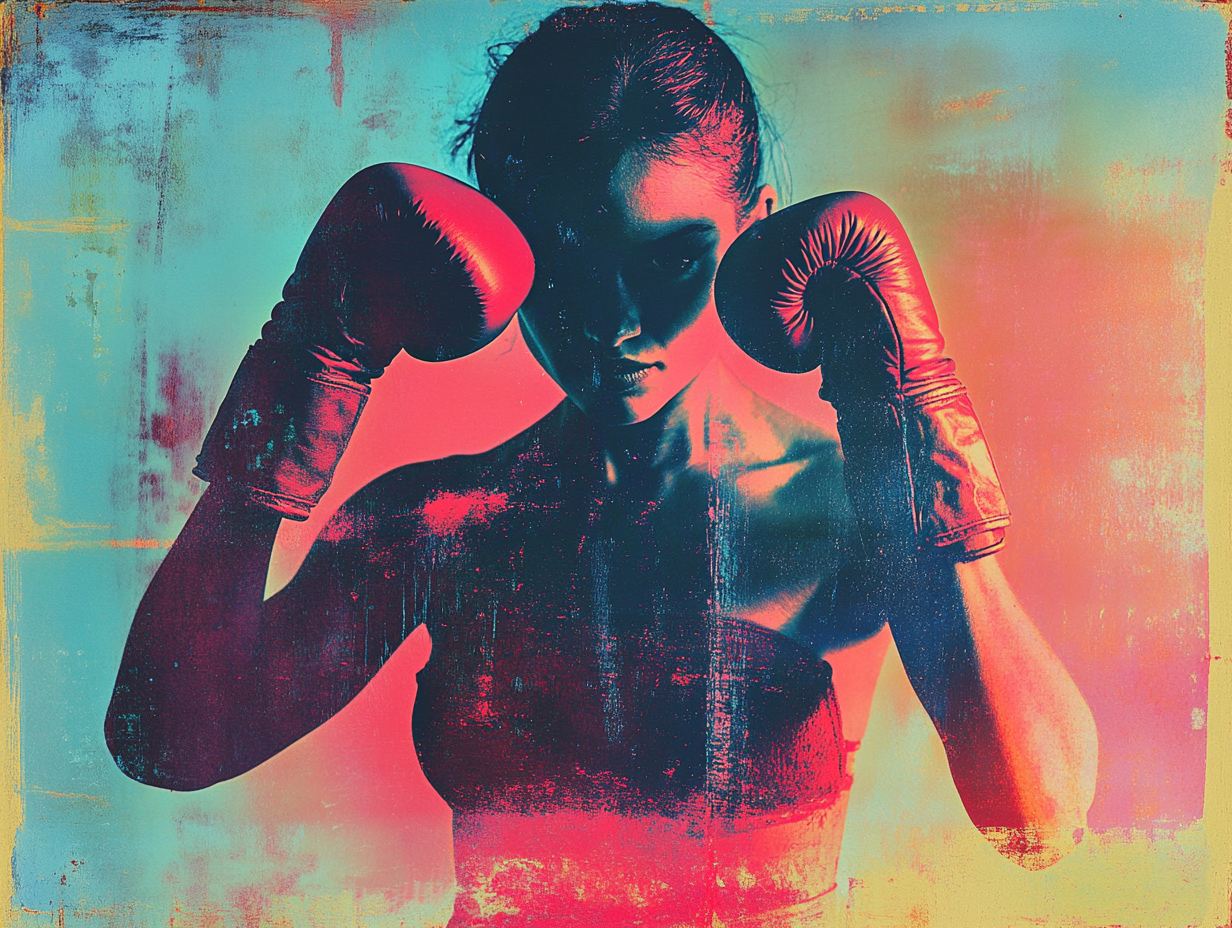
Sexismus ist nicht nur ein äußeres Problem – er wirkt auch innerhalb von Frauen. Eine der subtilsten, aber schädlichsten Formen davon ist internalisierte Misogynie – wenn Frauen selbst frauenfeindliche Einstellungen übernehmen. Oft geschieht das unbewusst, weil es als vermeintliche Überlebensstrategie dient. Aber was bedeutet das genau? Und wie können wir diesen Mechanismus durchbrechen?

Frauen sollen sich gegenseitig unterstützen – doch in vielen männlich geprägten Branchen erleben wir das Gegenteil: Frauen in Führungspositionen fördern oft keine anderen Frauen, sondern distanzieren sich bewusst von ihnen. Dieses Phänomen nennt sich Queen Bee Effect – und es ist kein Zeichen dafür, dass Frauen „besonders hart“ zu ihresgleichen sind, sondern eine Folge struktureller Diskriminierung.

„War doch nur ein Witz!“ – Ein Satz, der oft fällt, wenn jemand auf eine sexistische Bemerkung hinweist. Doch was steckt dahinter? Warum reproduzieren Menschen sexistische Aussagen, und warum werden sie in manchen sozialen Umfeldern toleriert, in anderen aber nicht? Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle.

Sexismus wird oft mit offenen, feindseligen Angriffen auf Frauen verbunden – mit Aussagen wie „Frauen sind weniger kompetent“ oder „Frauen manipulieren Männer durch Emotionen“. Doch Sexismus ist weitaus komplexer: Neben dem feindseligen Sexismus existiert auch eine scheinbar „positive“ Form – der wohlwollende Sexismus. Dieser tarnt sich als Kompliment oder Schutz, ist aber ebenso schädlich, weil er Frauen in traditionellen Rollen hält. Beide Formen zusammen stabilisieren patriarchale Strukturen und verhindern echte Gleichberechtigung.

Männer sind rational, Frauen emotional. Männer sind geborene Führungskräfte, Frauen kümmern sich lieber um andere. Solche Aussagen sind tief in unserer Gesellschaft verankert – doch sie sind nicht die Realität, sondern Ausdruck von Geschlechterstereotypen. Sie prägen, wie wir über Geschlechter denken, wie wir uns selbst sehen und welche Erwartungen an uns gestellt werden.

Sexismus ist ein gesellschaftliches Problem, das oft als Ergebnis von Erziehung, Kultur oder Gruppenzugehörigkeit betrachtet wird. Doch eine aktuelle Analyse zeigt, dass nicht nur diese Faktoren, sondern auch individuelle Denkstrukturen eine wesentliche Rolle spielen.

In der heutigen digitalen Ära entstehen ständig neue Begriffe und Phänomene, die unser Verständnis von Geschlechterrollen und sozialen Dynamiken beeinflussen. Eines dieser Phänomene ist das sogenannte "Pick-Me Girl". Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff, und welche Implikationen hat er aus feministischer Sicht?